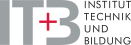Gestaltungsoptionen für die duale Organisation der Berufsausbildung
In enger Abstimmung erstellten das Institut Technik und Bildung (ITB) und die Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) zwei Gutachten im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Das ITB-Gutachten beschäftigt sich mit „Gestaltungsoptionen für die Organisation der dualen Organisation der Berufsausbildung“ und das sfs-Gutachten mit „Rahmenbedingungen der Weiterentwicklung das dualen Systems beruflicher Bildung“.
Beteiligt am Gutachten war weiterhin das Deutsche Jugendinstitut. Im sfs-Gutachten stehen Befunde zu ausgewählten Rahmenbedingungen beruflicher Bildung (Europa; Übergänge und Entwicklungen in der Arbeitsgestaltung) im Mittelpunkt und im ITB-Gutachten sind berufsbildungspolitische Gestaltungsoptionen benannt. Zunächst werden dabei die aktuelle Diskussion um die deutsche Berufsbildung in ihren einschlägigen Positionen vorgestellt und zentrale Dimensionen und Problemstellungen charakterisiert. Dabei wird deutlich, dass sich in der Diskussion zur Weiterentwicklung der Berufsbildung zurzeit zwei grundlegende Argumentationsmuster unterscheiden lassen: Modularisierung und Akademisierung.
1. Die Modularisierung wird mit dem Hinweis auf die Vielfalt der Bedürfnisse der Lernenden und von Seiten der Anbieter beruflichen Lernens (Betriebe, Schulen, Bildungsanbieter) gefordert. Ihr könne nur durch die zeitliche Flexibilisierung und inhaltliche Gliederung von individuellen Ausbildungsgängen Rechnung getragen werden. Die „Akademisierung“ hingegen sieht die Herausforderungen in einer „Wissensgesellschaft und Wissensökonomie“, der nur durch schul- und wissenschaftsorientierte Ausbildungsgänge zu begegnen sei. Beide Strategien werden im Gutachten unter Berücksichtigung verschiedener Überlegungen und empirischer Befunde um eine berufsbildungspolitische Strategie ergänzt, die sich an einem »betrieblich-beruflichen Bildungstyp« und dem Bezug zur Erwerbsarbeit als dem Ziel beruflicher Ausbildung orientiert.
2. Bliebe es bei den Alternativen „Modularisierung“ und „Akademisierung“, würde die Gestaltung der Prozesse des Lernens, Lehrens und Beurteilens von nur dieser Differenzierung abhängig gemacht. Wir haben eine dritte Alternative gesucht und geprüft. Die Verantwortung für die jeweilige Form der Kompetenzentwicklung ist nicht lediglich auf Individuen oder Betriebe zu beschränken, sondern sozialpartnerschaftlich zu übernehmen. Dazu scheint es am besten der betrieblichberufliche Bildungstyp geeignet. Jedoch bietet er noch keine hinreichend ausformulierten Prinzipien, nach denen ein Bildungssystem im Ganzen konzipiert werden kann. Ein solches Bildungssystem müsste sich an - europäischen - Kernberufen orientierten und dabei auf das Prinzip der sozialen Integration auf der Stufe der allgemeinbildenden Schulen bauen. Es entstehen damit zwei Herausforderungen:
a) die konsequente Gestaltung der Dualität als Prinzip beruflichen Lernens und b) Durchlässigkeit beruflicher Bildungsgänge zur allgemeinen Bildung. Anhand verschiedener empirischer Befunde zum Zusammenhang von Bildung und Arbeitsmarkt und zur beruflichen Kompetenzentwicklung werden diese drei Strategien untersucht und ihre möglichen Konsequenzen veranschaulicht. Gleichzeitig werden aber auch die Unterschiede zwischen dem sogenannten dualen System als Realtypus beruflicher Bildung in Deutschland und dem Idealtypus des betrieblichberuflichen Bildungstyps illustriert. Einige Befunde werden nachstehend in kurzer Form wiedergegeben. Die Existenz beruflicher Bildung als attraktive und quantitativ starke Variante im Bildungssystem erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler einen beruflichen Abschluss erwerben, bevor sie ins Erwerbsleben eintreten. Überdies kann gezeigt werden, dass eine duale, also eine zum Arbeitsmarkt integrative und gestalterisch wirkende Berufsausbildung für Absolventen ein effektives Mittel ist, Phasen der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen einzugrenzen und damit auch die Jugendarbeitslosigkeit insgesamt zu vermindern. Allerdings wird es in Zukunft darauf ankommen, die Qualität der Verläufe und der Übergänge genauer zu analysieren. Durch Indikatoren zu den sich vollziehenden Übergangssequenzen wird das Argument der Leistungsfähigkeit dualer Berufsbildungsstrukturen im internationalen Vergleich unterstützt. Für den betrieblichberuflichen Bildungstyp bedeutet das, zunächst an der Korrespondenz zwischen Bildung und Arbeitsmarkt festzuhalten, da diese prinzipiell geeignet zu sein scheint, einen raschen und sinnvollen Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Allerdings zeigen gerade die sehr konträren Beispiele Dänemark und Irland, wie groß das Spektrum der erfolgreichen Gestaltung von Übergangssequenzen sein kann. Herausforderungen, denen sich Länder mit einer hohen Akademikerquote und einem geringen Ansehen beruflicher Bildung entgegengestellt sehen, verweisen auf die Bedeutung des erfahrungsbasierten Lernens im Arbeitsprozess und auf »matching«-Probleme, die bei einer Konzentration auf einen akademischen Bildungstyp entstehen könnten. Dualität ist u. E. nicht ein ausschließliches Charakteristikum der Berufsbildung im dualen Systemen, sondern eine allgemeine Eigenschaft von Lernprozessen im Rahmen von Bildungs- und Erwerbsbiographien, die zur Berufsfähigkeit führen. Wenn berufsqualifizierende Lernprozesse so umfassend betrachtet werden, wird auch deutlich, wo die Grenzen einer Modularisierung liegen oder wie schwierig es ist, die Lernprozesse in kleine, unabhängige Lerneinheiten zu unterteilen.
Aus einer berufspädagogischen Sicht stellt sich die Frage nach fachlich kompetenter Arbeit und ihren Strukturen vor allem in Bezug auf das in entsprechenden Arbeitsprozessen erforderliche Wissen. Die häufig erfolgende polarisierte Differenzierung nach „einfacher“ und „komplexerer“ Arbeitstätigkeit wird den verschiedenen Gestaltungsfragen nicht gerecht, die sich aus einer berufspädagogischen Sicht stellen. Auf der Basis verschiedener Analysen, die im Rahmen von berufswissenschaftlichen Studien durchgeführt wurden, erscheint es möglich, Unterschiede im Hinblick auf wesentliche Dimensionen von fachlich kompetenter Arbeit festzustellen. Eine solche horizontale Differenzierung um die Gestaltung von Berufen und Berufsbildung findet bisher in der Diskussion um duale Berufsbildung kaum Berücksichtigung. Es werden drei Kategorien von Arbeitsstrukturen identifiziert:
- technologisch-wissensbasierte Arbeitsstrukturen,
- prozessbezogene Arbeitsstrukturen und
- aufgabenbezogene Arbeitsstrukturen.
Diese verweisen auf verschiedene Typen von fachlich kompetenter Arbeit. Das bedeutet, dass die Gestaltung der Prozesse des Lernens, Lehrens und Beurteilens von dieser Differenzierung abhängig gemacht und einer teilweise irreführenden vertikalen Differenzierung entgegensetzt werden können. Die Kernbestandteile eines zukunftsfähigen betrieblich-beruflichen Bildungstyps sind u. E. die Synchronizität von erfahrungsbasierter Kompetenzentwicklung und schulischen Lehr– und Lernprozessen mit dem Ziel der Herausbildung von beruflicher Handlungskompetenz. Durch einen inkrementellen, begleiteten Rollenwechsel von Auszubildenden zur Erwerbsperson ermöglicht dieser Typus eine Integration der Herausbildung persönlicher, sozialer und fachlicher Fähigkeiten und Einstellungen. Die Verantwortung für die Form der Kompetenzentwicklung ist nicht lediglich auf Individuen oder Betriebe beschränkt, sondern wird sozialpartnerschaftlich übernommen. Zur Realisierung dieses betrieblich-beruflichen Bildungstyps werden im Gutachten Prinzipien für ein Bildungssystem konzipiert. Ein solches Bildungssystem würde sich an (europäischen) Kernberufen (Heß/Spöttl 2008) orientieren, auf das Prinzip der Integration für die allgemein bildenden Schulen bauen, Dualität als Prinzip beruflichen Lernens realisieren und größtmögliche Durchlässigkeit für die beruflichen Bildungsgänge zur allgemeinen Bildung realisieren.